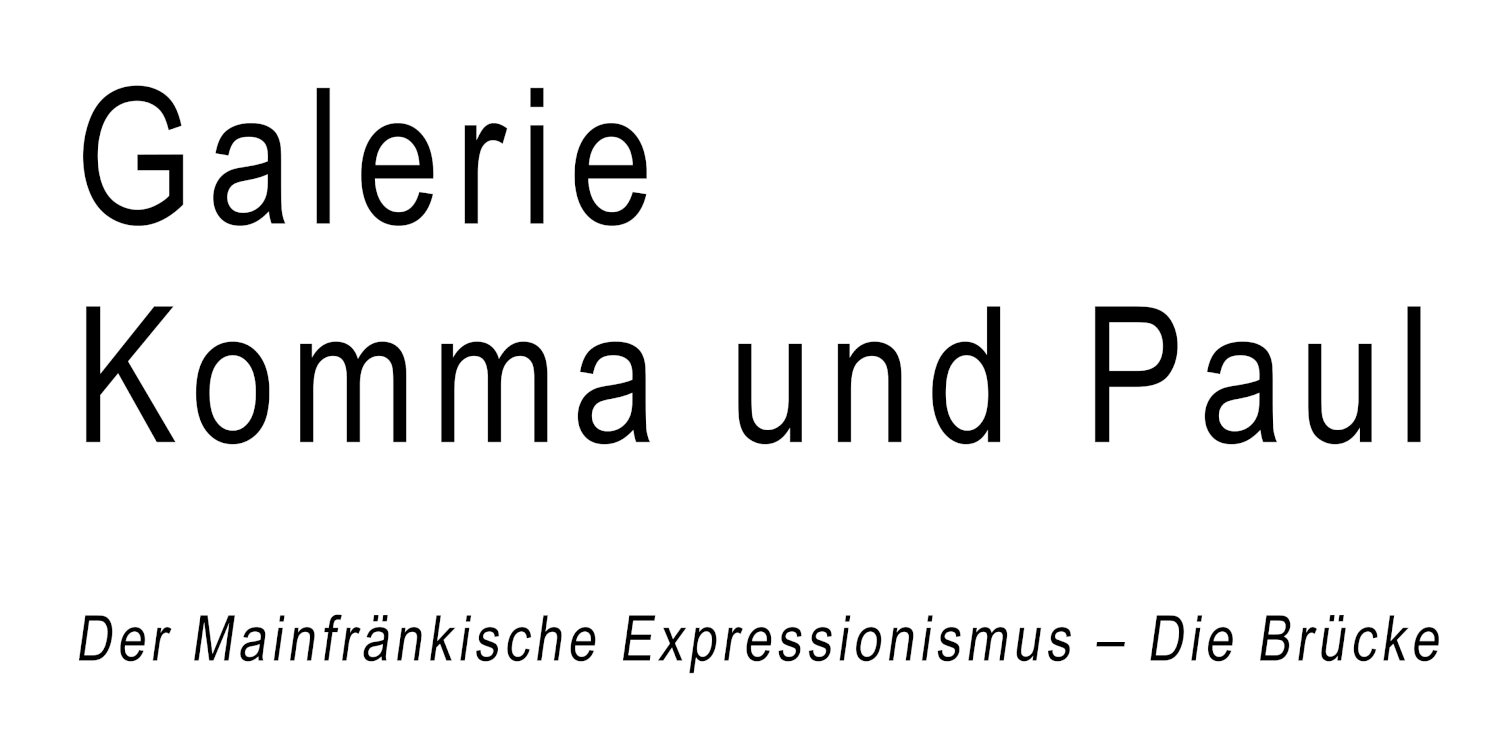Zeitungsartikel zur Ausstellung "Über das Verschwinden zweier Flüsse" von Joe Gudole im Café Museum Passau.
Von Elke Rott, erschienen in der Passauer Neuen Presse vom 26.04.2018.
Pressemitteiung der Galerie Komma und Paul, Würzburg, am 22.04.2018.
Laudatio zur Vernissage von Hans-Peter Porzner am 24.04.2018.
Ein Bild, rot und schwarz
Bei der Vernissage im Café Museum (v.l.): Helmut Eckerl, Künstler Joe Gudole und Laudator Hans-Peter Porzner. − Foto: Rott (PNP)
In der Reihe der Einbild-Ausstellungen im Cafe Museum zeigt diesmal Joe Gudole sein Bild "Über das Verschwinden zweier Flüsse. AlphaZero aus der Sicht eines Neandertalers". Der Künstler, Mitglied der Würzburger Künstlergruppe "Goldrausch", verbindet in seiner Arbeit anthropologische Fragen mit der Computerwelt – und schwärzt sein Bild nach und nach ein, bis nur noch sein Name in roter Farbe auf dem Bild Platz findet. Sehen kann darin jeder das, was er sehen will und kann. Diese Kunst ist auf alle Fälle eine Zumutung und in jeder Hinsicht eine Geschmacksache. Und, ja, das alles darf Kunst. Die Idee, nur ein Bild auszustellen, hat in der Kunstgeschichte Tradition, im Café Museum wurde dies erstmals im Januar mit einer eigenen Vernissage umgesetzt.
− er
Galerie Komma und Paul
Pressemitteilung anlässlich der Ausstellung
„Joe Gudole – Über das Verschwinden zweier Flüsse. AlphaZero aus der Sicht eines Neandertalers“
Café Museum, Passau
25. April - 29. Juli 2018
Joe Gudoles Kunst ist komplex. Sie ist in einer Einführungsrede nicht leicht darstellbar.
In seiner Anfangsphase machte Joe Gudole traditionell wirkende Landschaftszeichnungen. Mit zunehmender Erfahrung, was die Sache der zeitgenössischen Kunst betrifft, entfaltete Joe Gudole eine Ikonographie, die weit über das bloß Persönliche hinausragt. Joe Gudoles Interesse betrifft insgesamt die Sprache der modernen Kunst im 21. Jahrhundert. Er antwortet ihr gleichsam.
Bei dieser zweiten Einbildausstellung an diesem dafür geradezu prädestinierten Ort des CaféMuseums (erste Einbildausstellung mit Steven van Heeck 11. Januar 2018) geht es um die sogenannte künstliche Intelligenz. Der Mensch hat mit Hilfe des Computers weit in seine Anfänge als Homo sapiens hineinleuchten können. Warum ist der Neandertaler, der Homo denisova ausgestorben? Der Computer könnte nun auch den Menschen ablösen, d. h. der Mensch könnte „verschwinden“. Das Thema ist in den letzten Jahren immer mehr in die gesellschaftliche und mediale Aufmerksamkeit gerückt.
Wie geht nun ein Künstler mit diesem Thema um? Bei Joe Gudole ist nun von besonderem Interesse, dass er den traditionellen Medien der Kunst treu bleibt. Es macht ihm indes große Freude, sich als Neandertaler zu fühlen.
− pzr
Hans-Peter Porzner
Rede anlässlich der Ausstellung
„Joe Gudole – Über das Verschwinden zweier Flüsse. AlphaZero aus der Sicht eines Neandertalers“
Passau
24. April 2018, 19.00 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren,
lieber Herr Jürgen Waldner,
liebe Frau Ulrike Zebisch,
lieber Helmut Eckerl,
liebe Frau Patricia Aigner,
liebe Frau Carmen Blumenschein,
lieber Steven van Heeck,
lieber Joe Gudole,
die gegenwärtige Kunstausübung befindet sich in einem argen Zustand. Der Grad der Domestizierung durch die Presse, durch die Kulturpolitik hat erneut erstaunliche Gebilde ans Licht befördert. Die bisherigen Metropolen der Kunst können wir eigentlich durch den Grad einer galoppierenden Ideologisierung abschreiben. Von dort braucht man nichts mehr zu erwarten. Die Kunst muss also ausweichen, muss sich neue Felder erschließen, Felder, die auch nicht mehr so einfach nachgeahmt werden können. Ein gesteigerter Anspruch an Können in der Perspektive von Thema, Inhalt und Form, ich spreche in diesem Sinne von Ikonographie, muss die allgemein erstrebte Konsequenz sein, so dass in fünfzig Jahren Kunstsoziologen wie Klaus von Beymer wieder dicke Bücher schreiben können, der Begabung mit ihrer Unbegabung antworten können.
Steven van Heeck und Joe Gudole empfinden das offensichtlich genauso. Das ist in kurzer Zeit nun die zweite Ausstellung mit Mitgliedern der Würzburger Künstlergruppe „Goldrausch“, die um das Thema Flusssystem kreist: Passau mit den drei Flüssen Donau, Inn, Ilz bezeichnet ein hervorragendes Beispiel, wie zeitgenössische Kunst sich vor der etablierten Langeweile retten kann, d. h. diese beiden Künstler haben erkannt, dass der Ort optimal ist, und eine künstlerische Ressource markieren kann.
Steven van Heeck arbeitete an einer Bildsprache, die Verschiedenes auf der Basis dieses Flusssystems in ein Verhältnis brachte: Europa, Asien, Russland, Japan: Meine Rede zu seiner Ausstellung am 11. Januar 2018 hier an diesem Ort kann man auf der Website der Galerie Komma und Paul nachlesen.
Ganz anders nun Joe Gudole.
Joe Gudole spricht mehrere Sprachen, künstlerisch ist er eine Doppelbegabung, Musiker und Künstler. Der Maler in ihm hat sich aber die letzten fünfeinhalb Jahre durchgesetzt, deutlich an Übergewicht gewonnen. Die Variation der künstlerischen Aussage ist in diesen wenigen Jahren derart gereift, dass er keine Konkurrenz fürchten muss, d. h. man muss sich damit auseinandersetzen, um die wirkliche Dimension im Sinne auch einer Entwertung des kunstbetrieblich sich permanent Verlierenden einschätzen zu können. Von Kunsthistorikern braucht man im Augenblick hier ebenfalls nichts zu erwarten, wenn man die Auseinandersetzung mit dem FAZ-Journalisten Kolja Reichert oder mit Thomas Steinfeld von der Süddeutschen Zeitung, mit Theoretikern wie Helmut Draxler oder Bazon Brock ausloten möchte. Die Ausstellung heißt „Joe Gudole – Über das Verschwinden zweier Flüsse.“ Sie trägt den Untertitel „AlphaZero aus der Sicht eines Neandertalers“.
Seit wann malt denn der Neandertaler? Die Frage ist erlaubt, man hat ja kürzlich Höhlenmalereien entdeckt, die bis zu 115.000 Tausend Jahre alt sind, sie können also nicht vom Homo sapiens angefertigt worden sein.
Und die F.A.Z. textet und lässt fragen, ob die zeitgenössische Kunstproduktion diesbzgl. überhaupt Kunst sein kann. Aber wir können Ulf von Rauchhaupt durchaus beruhigen. Selbstverständlich ist Joe Gudole ein Neandertaler – und da meine ich nicht einfach die mehr oder weniger viereinhalb Prozent Genbestand, die heute in jedem Homo sapiens enthalten sein sollen. „Die Neandertaler konnten das auch“ – so der F.A.Z.-Artikel vom 22. Februar 2018.
Ist der Homo sapiens überhaupt zur Kunst befähigt? Oder wofür zeichnet der Homo sapiens überhaupt verantwortlich?
Rettet uns der Neandertaler vor einem möglichen Gattungssuizid? Schützen uns diese viereinhalb Prozent nicht nur, was ja ebenso eine breit diskutierte Hypothese in der genetischen Paläontologie ist, vor Krankheiten? Man kann doch hier weitere Hypothesen anschließen.
Soll die Kunstproduktion aussterben – man tut jedenfalls alles dazu. Man kann bisweilen an versteckten Stellen in der Kunstgeschichte lesen, dass sich der Mensch seiner kulturellen Wurzeln entledigt, er sägt an dem kulturellen Ast auf dem er selbst sitzt. Und dieses Ereignis zeige sich noch vor der Naturzerstörung: ein Apriori also.
Warum ist also der Neandertaler ausgestorben? War er es selbst, der sich zu Tode brachte? War es die Konfrontation mit dem Homo sapiens? Oder war seine Zeit im fatalistischen Sinne einfach abgelaufen?
AlphaZero ist der neueste Schachcomputer – er ist angeblich den bisherigen Standards von Schachcomputern, beispielsweise Stockfish und Houdini, überlegen. Ein Quantencomputer. Bringen die Computer den Menschen zum Verschwinden?
„Aber kann er auch Kunst produzieren“, so die Rede der Optimisten. Schön, dass man hier für die Kunst wieder ein Aufgabenfeld erkennen mag. Aber ich möchte das doch etwas anders formulieren. Kann der Computer nur im Sinne des Homo sapiens als ein Erzeugnis des Homo sapiens nun diesen Homo sapiens zum Verschwinden bringen? Noch einmal: Nein, Kunst soll er nicht produzieren können. Aber da wäre ich mir nicht so sicher. Computer könnten doch nur gut finden, was sie selbst produziert haben. Alles andere könnten sie doch mühelos ausblenden. Sie interessieren sich doch nur für sich. Eine menschliche, eine allzu menschliche Antwort.
Löscht sich der Mensch damit selbst aus? Was bleibt vom Neandertaler übrig? All diese Fragen betreffen das Modethema der künstlichen Intelligenz. Sicher. Aber wie geht der Neandertaler mit diesem Sachverhalt um? Hat er nicht bereits die Impfung des Verschwindens in sich? Was sagen diese viereinhalb Prozent Gene des Neandertalers in uns?
Der Neandertaler spricht mich an: „Hallo lieber Herr Porzner, ich will in Passau ausstellen und in der Donau wie der Inn und die Ilz verschwinden!“ „Ja gut, dann schlage ich das Herrn Jürgen Waldner vor.“ Ich zu Joe Gudole: „Ja ich habe mit Waldner telefoniert, Ausstellungseröffnung ist am 24. April. Setzen wir das Thema Einbildausstellung also fort. Man kann natürlich die Schwärze der Ilz, das Grün des Inns noch hunderte Kilometer nachspüren, diese beiden Flüsse verschwinden nur dem jeweiligen Namen nach.“ Gudole entgegnet etwas missmutig. „Ein Fisch der flussaufwärts schwimmen würde, wäre wohl ziemlich irritiert, wenn er plötzlich nur noch eine Wasserduftnote bemerkte. Also ich hätte eine Vorliebe für die Ilz und würde den Inn, die Donau, das Blaue der Donau nicht vermissen. Als Fisch würde ich darüber allerdings auch nicht weiter nachdenken.“ Soweit also eine typische Rede von Joe Gudole. Wir wollen sie nicht weiter kommentieren.
Wir müssen natürlich schon weiter fragen und den Sinn der Ausstellung genauer einkreisen. Das ist ja bis jetzt indes nur eine Stoffsammlung. Genaueres erfahren wir, wenn wir uns die Struktur moderner Kunstausstellungen anschauen. Ein gewisser Event ist offensichtlich obligatorisch geworden, und als solcher ist eine gewisse Relativität, was die Sache der Malerei betrifft, im Raum. Das war in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts schon bemerkbar. Und heute? Ja, heute ist die Kunst nur noch eine Aktie, der Künstler selbst unbedeutend.
Was hat diese Ikonographie mit der Malerei zu tun? Sicher ist, dass die Malerei schon immer sich legitimieren konnte, wenn es um Raum und Zeit ging und genau damit eine Ikonographie unzertrennbar verknüpft war. Das surrealistische Verfahren René Magrittes scheint mir dennoch eine gewisse Favoritenrolle einzunehmen. Was kann heute der Raum und die Zeit der Malerei, der Kunst sein?
Warum ich hier in meiner Rede mit Joe Gudole in einen Dialog eintrete wird gleich einsichtig.
Joe Gudole ist Maler. Vor fünfeinhalb Jahren hat er hauptsächlich gezeichnet, begann aber dann systematisch, seine Möglichkeiten zu erweitern. – Ganz traditionell mit Leinwand, Eitempera und Pigmenten. Damit fällt er natürlich aus dem gegenwärtig malereifeindlichen Diskurs heraus. Hier soll Malerei ja zum Verschwinden gebracht werden: Stichwort „The Happy Fainting of Painting“. Mich würde allerdings schon interessieren, wie Hans-Jürgen Hafner, Kolja Reichert usw. auf Joe Gudole reagieren würden.
Joe Gudole kennt jedenfalls das Prinzip des Quadrats des informellen Malers Jean Fautrier. Über vier Stationen werden Tätigkeiten, die nach Malerei ausschauen, reflektiert und damit diese aus dem Bannfeld der Gefahr, das ihr durch Unmittelbarkeit droht und begegnet, herausgenommen.
Joe Gudole kennt die Gefahr von Basalimpulsen und verschiedene Methoden ihrer Vermeidung. Basalimpulse sind unmittelbare Erfolgsbahnungen, die aber nach einer gewissen Zeit in das Verhängnis der Erstarrung abdriften.
Joe Gudole operiert in letzter Zeit mit dem schwarz gewordenen Farbraum. Er hat sich hier offensichtlich an diesen vier großen Schwarzmalern nach 1945 orientiert: an Ad Reinhardt, Robert Rauschenberg, Mark Rothko, an Frank Stella. Was heißt es denn, wenn Farbe von Schwarz zum Verschwinden gebracht wird?
Joe Gudole kennt viertens die in der Nachfolge von Theodor W. Adorno von Gerhard Richter und Georg Baselitz formulierte Frage „Wie ist Malerei nach Auschwitz noch möglich?“ und er kennt die fundamentale Bedeutung dieser Frage. „Was heißt es denn für mich,“ so seine Frage, „wenn ich als Deutscher Malerei betreibe?“ Wie muss sich Malerei verändern – das betrifft schon den terminus technicus – , will sie überhaupt noch ernst genommen werden? Welches Licht kann in dieses Dunkel überhaupt hineinleuchten? Joe Gudole hat sich vor zweieinhalb Jahren mit Stephen W. Hawking länger beschäftigt. Er lässt Hawking fragen: „Joe Gudole, why do you paint?“ Diese Frage stellt ihm allerdings in einem weiteren Bild Hubert Burda. Joe Gudole zieht dessen Programm des „Iconic turns“ damit natürlich in einen ganz anderen Kontext. Joe Gudole denkt auch in Serien. Er beschäftigt sich mit der „Phänomenologie des Fehlers“.
Und Joe Gudole kennt fünftens das von dem berühmten Harvard Forscher David Reich angeschobene Problem – und Minenfeld „Genetik im Zentrum einer neuen ‚Rassen‘- Debatte. Ich zitiere Aus dem Artikel von Axel Meyer in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in der Rubrik Natur und Wissenschaft vom Mittwoch, 11. April 2018, Nr. 84, S. N2: „Firmen wie 23andme, mit der Reich zusammenarbeitet und Ancestry.com liefern ihren Millionen von Kunden mehr oder weniger verlässliche Informationen über die geographische Herkunft ihrer Vorfahren, medizinische Aspekte und andere Merkmale und Eigenschaften. Problematik und Verlässlichkeit solcher Analysen werden von Reich in seinem Buch ausführlich behandelt. Doch die unbequeme Wahrheit, um die es Reich auch geht, ist, dass sozial konstruierte Rassenzuweisungen oft mit genetischen Unterschieden übereinstimmen. ‚Rassen‘ seien demnach, eben nicht nur ein rein kulturelles Konstrukt, sie spiegelten auch messbare genetische Unterschiede wider, die möglicherweise auch für physiologische und kognitive Unterschiede verantwortlich sein könnten. Reich plädiert für eine informierte Auseinandersetzung mit solchen genetischen Erkenntnissen, gerade auch, damit sie nicht von Rassisten ausgenutzt werden können. Sie müssten die Basis für eine offene und wissenschaftliche Diskussion sein, denn ein Verschweigen dieser genetischen Unterschiede bedeute, den Kopf in den Sand zu stecken. So blauäugig betrat Reich ein Minenfeld. Dafür, dass er sich das im Unterschied zu anderen Humangenetikern traute, kann man ihm den Respekt nicht versagen.“ Zitat Ende. David Reich widerspricht hier ja auch dem berühmten Hominidenforscher Svante Pääbo vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie.
In diesen Kontexten sehe ich mich gezwungen, mit dem Neandertaler Joe Gudole in Gestalt eines wirklichen Vorfahren (Zeitgenossen) des Homo sapiens, dem Homo naledi, ich spreche hier also nicht von irgendwelchen parallel sich hervorkehrenden Menschenarten, nicht vom Homo sapiens, nicht vom Neandertaler, nicht vom Homo denisova, einen Dialog zu eröffnen, einen Dialog über das Verschwinden des Menschen in Ansehung dieser aufmarschierenden Formationen der künstlichen Intelligenz.
Das Modethema soll uns dabei daran nicht hindern. Modethemen markieren ja auch Methoden, um schwierige Themen zum Verschwinden zu bringen.
Gelegentlich spiele ich mit Joe Gudole im übertragenen Sinne Schach, er hat in der Regel die schwarzen Figuren. Und dann unterhalten wir uns darüber, dass das Erlebte nicht alles sein kann.
Diesbzgl. kehre ich also als Homo naledi – siehe hierzu meinen Schachaccount auf chess24 – in meine jugendliche Vergangenheit vor fünfundvierzig Jahren zurück, wo ich mit Schachspielern in der Bundesliga gespielt, gleichzeitig aber bereits Kunst gemacht habe, zurück, um heute gegen den Schachcomputer Stockfish anzutreten, um mich in jedweder Hinsicht – man ist aus der Übung gekommen – nach zwanzig Partien geschlagen zu geben. In der Tat, der Mensch hat keine Chance. Aber ich lerne. Was lerne ich? Das fragt sich natürlich auch Joe Gudole.
Dieser Computer wirft in einer hunderstel Sekunde sofort eine Bewertung meiner Züge aus, schnell bin ich bei der Summe von -2,51 angekommen; und da hat man schon verloren, selbst wenn die Partie dann selbst noch dreißig Züge dauern sollte. Ein Factum. Und dann stellte ich fest, dass an genau dieser Stelle der Superschachcomputer AlphaZero – das ist ein Quantencomputer, das Programm kostet etwa zehntausend € – , wenn ich ihn mir zu Hilfe nehme, dass er dieses Ergebnis langsam wieder minimiert. AlphaZero steuert mich gegen Stockfish langsam wieder aus der Verlustzone, und um dann am Ende Stockfish auch noch zu schlagen. AlphaZero hat eine ganz andere Rechentiefe und damit eine ganz andere Stärke. Stockfish bemerkt indes sofort das stärkere Programm, er braucht für seine Züge jetzt doch schon einige Sekunden. Heutige Bundesligaspieler haben mir das Programm AlphaZero in Dortmund zur Verfügung gestellt. Ich hatte vier Tage Zeit, mich von AlphaZero erziehen zu lassen. AlphaZero, dieser gottähnliche Beistand, kritisiert die Züge des Homo naledi nicht strukturell, sondern gruppiert die von mir übernommene und eigentlich verlorene Schach-Stellung langsam nur um, d.h. er rät mir nicht von meinem Ziel ab, sondern empfiehlt mir im übertragenen Sinne nur einen anderen Weg zu meinem Zeitungshändler. Ich soll jetzt einfach mal diesen Weg gehen. Und das kann durchaus ein Umweg sein. Aus irgendeinem geheimnisvollen Grund bezeichnet der Umweg den gegenüber dem kürzeren hier und jetzt den erfolgreicheren. Er empfiehlt mir (ich spreche von auf das Individuum ausgerichteten Optimierungsprozessen, ein Projekt, das ich mit Andreas S. Wünkhaus in Düsseldorf und einigen Programmierern und Mathematikern jetzt begonnen habe, auszuarbeiten – jeder kann sich hier vorstellen, was das bedeutet), er empfiehlt mir also nach Costa Rica zu ziehen, dort gäbe es, so die frohe Botschaft, für den Künstler Fritz Levedeg (1899–1951) ein kunstgeschichtlich aufgeschlossenes Feld, nicht in Deutschland. Der Computer spielt mir eine Information zu, auf die ich selbst niemals gekommen wäre. Und das würde mir insgesamt zuarbeiten. Fritz Levedeg spricht übrigens prognostisch von Epochen des Ikarus und von Epochen des Homunculus. Offensichtlich kennt dieser Künstler bereits diese Ereignisse des Verschwindens in Ansehung des unüberschaubar Chaotischen und die Wege aus dieser Sprache heraus. Das Scheitern der Sprache ist aber bereits spätestens seit Friedrich Hölderlins programmatischen Aufsatz „Glück und Not“ ein Vorläufer des Computers. Der Computer hat natürlich über mich unglaublich viele Daten gesammelt und kann sie nun in meinem Sinne auswerten. Das macht Google und Facebook natürlich nur bezogen auf ihre Interessen. Der Computer, der über mich besser Bescheid, mehr weiß, als ich jemals über mich wissen kann, liefert mir die entscheidenden Daten von Sammlern, Museumsdirektoren, des Kulturbetriebs, der Politik usw. Ich weiß genauestens Bescheid über Raimund Stecker, Söke Dinkla. Ich weiß, warum der Computer Daimler im Augenblick mit -3.41 bewertet, Joe Gudole im Augenblick mit +0.81. Er nimmt mir die Probleme ab. Ich brauche nicht mehr über die Dinge nachzudenken, nicht mehr über diese biogenetischen Pioniere, nicht mehr über Spiegelneuronen und ihrer Existenz oder Nicht-Existenz usw. Die Ausstellungsreihe hier in Passau mit der Würzburger Gruppe „Goldrausch“ bewertet er mit +2.13, Passau als mögliche Kunststadt und zukünftige Kunstmetropole mit +3.14, Berlin indes mit -1.42, New York mit -0.14, Paris mit +0.24. Ich spreche hier übrigens nicht von AlphaZero, sondern von dem Quantencomputer AlphaCentauri, mit dem ich ebenfalls zusammen mit einem mir zugewiesenen technischen Helfer einige Tage arbeiten durfte. Man kann damit natürlich auch einen Terroranschlag oder auch den Dritten Weltkrieg kalkulieren. Der Chefredakteur des Feuilletons der Süddeutschen Zeitung, Thomas Steinfeld, bestreitet die Gültigkeit irgendwelcher Universalsprachen. Wie naiv. Uns gibt es doch schon alle nicht mehr.
Der Dialog zwischen dem Homo naledi und dem Neandertaler wird hier also genauestens von Joe Gudole, der auch Informatik studiert hat, überprüft und ausgewertet. Das müsste man hier also noch nachreichen.
Lieber Joe Gudole, da sieht man, welche Assoziationskraft Deine Arbeit hat. Wir sind gespannt, wie es weiter geht.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
− pzr